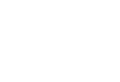Irgendwann bleib’ ich dann dort
Über das Reisen und die Sehnsucht, nicht wiederzukehren
Sommerzeit ist Reisezeit. Markierte früher das Interrailticket kombiniert mit Schlafsack und ein paar warmen Dosenbier den temporären Abschied aus dem Alltag, so greift man heute – etwas reifer und damit gesetzter – auf den bewährten Reisedealer seines Vertrauens, schlechtestenfalls auf die Restplatzbörse im Internet zurück.
Mag sein, dass der Transfer sich heutzutage komfortabler gestaltet, an der grundlegenden Urlaubserwartung – abgesehen von einigen sportiven Überzeugungstätern – hat sich nicht viel verändert. Auf der Projektionsleinwand flimmert der allseits bekannte Film von Sonne und Meer, garniert mit möglichst viel an „authentic environment“.
Einmal angekommen und in den entspannten Aggregatzustand übergegangen, materialisiert sich nur allzu leicht die Idee – als Katalysator reicht erfahrungsgemäß bereits ein ausgedehntes Essen samt trinkbarem Wein an einem lauen Abend –, dass eigentlich alles anders sein könnte. Nachdem bereits die ganzen Geschichten von entfremdeter Arbeit bis zur Unterwerfung sämtlicher Beziehungen unter die Verwertungslogik in der heimischen Stammkneipe durchdekliniert worden sind und die Alternative, „irgendwie das System völlig anders zu gestalten“, auch nicht wirklich greifbar ist, kramt man kurz in den Shellaks und legt daraufhin fast automatisch die vertraute Platte des Auswanderns bzw. Aussteigens auf.
Der liebliche Klang trägt die involvierten Protagonisten sogleich in eine vermeintlich romantische Vorzeit, in ein Leben mit unzweideutigen Zuordnungen und Zuständen, schlicht lesbaren sozialen Landkarten, und was liegt da wohl näher als ein Neubeginn als uriger Handwerker mit einem super düsteren Laden in einer der verwinkelten Altstadtgassen, oder noch radikaler: Bauer mit artgerechter Tierhaltung, dafür ohne Elektrizität. Nun lösen sich Verwirrungen dieser Art bekanntlich kurz nach Ankunft in gewohnter Umgebung auf. und bei besonders renitenten Personen erweist sich die erste Arbeitswoche als äußerst effektives Gegenmittel.
Trotz alledem soll es entsprechend dem dämlichen Kalenderspruch „Ausnahmen bestätigen die Regel“ immer wieder vorkommen, dass von latenter Sehnsucht Getriebene tatsächlich versuchen, ihr Vorhaben in die Realität umzusetzen. Völlig zurecht wird dieser Akt der Entschlossenheit in den meisten Fällen mit einer romatischen Startphase belohnt, jedoch lassen die ersten Enttäuschungen nicht lange auf sich warten. Die vermeintliche Authentizität erweist sich bei einem genaueren Blick hinter die Kulissen schlicht und einfach als konkreter Ausdruck von ökonomischer Rückständigkeit mit all ihren Konsequenzen. Fehlt das nötige monetäre und soziale Kapital, um zumindest kurzzeitig den Privatier abgeben zu können, so rückt die Reorganisation der scheinbar banalen grundlegenden Notwendigkeiten wie Arbeit und Wohnung meist heftiger denn je ins Zentrum des persönlichen Mikrokosmos.
In solch einer Situation betritt recht gerne der Bruder des Fernwehs, das Heimweh, bepackt mit einem Bündel an Zweifeln die Bühne. Steht man letztendlich also wiederum vor dem alten Dilemma? Keinesweg, gilt es doch lediglich zu erkennen, dass (Sehn)sucht nur im Kombipack mit einer Form des Wehs erhältlich ist.
Lesetipp:
Janosch: Oh, wie schön ist Panama, ISBN 3 407 80533 0