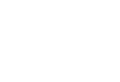Bedeutungsschwangere Staatsoperette
Zuerst etwas politische Bildung für unsere jungen LeserInnen: Was ist eine Republik? In neuerer Zeit versteht man darunter eine Staatsform, bei der die Gewalt nicht nur bei einer Person ruht.
Seit dem 4. Juli des heurigen Jahres schleppt das Wort „Republik“ völlig neue Konnotationen mit sich herum. An diesem geschichtsträchtigen Datum (US-Amerikanischer Unabhängigkeitstag) rief die Szene Salzburg ihre neue, aber eigentlich im Bar- und Foyerbereich wenig veränderte, also alte Spielstätte zum „Staat der Künste“ aus, und die Eröffnung wurde zur „Erklärung der Unabhängigkeit“. Voll semiotischer Demut nennen die Szene-Strategen das ehemalige Stadtkino „republic – state of the arts“. „State of the arts“ meint wohl einerseits „(künstlerisch) auf der Höhe der Zeit“, andererseits „Staat der Künste“.
Szene-Chef Michael Stolhofer verkauft den Namen frei von Understatement: „Damit ist der Nimbus verbunden, den dieses Haus von Anfang an hatte: ein urbanes Flair, das sich vom Provinziellen deutlich absetzt, und da unser Programm vom internationalen Blickwinkel bestimmt ist, haben wir den englischen Titel gewählt. »Res publica« bedeutet auch ein offenes Haus, das eine öffentliche Sache bleiben soll.“
Das klingt beeindruckend. Aber besitzt nicht jeder Staat, ob Monarchie, Bananen- oder Volksrepublik, Grenzen, die es gegen die Horden der Habenichtse (und sei es die Hybris, die diesen fehlt) zu verteidigen gilt? Den Assistenzeinsatz zur Zeitgeistkompatibilität erledigen im „republic“ die Türsteher. Keinen Schutz bieten die Gesichtskontrolleure gegen die Widrigkeiten der Gastronomie im „republic cafe“. Wer sich bei einem beliebigen Samstagabend-Clubbing mit US-Budweiser als einzig erhältlichem »Bier« abfertigen lassen muss, der sehnt sich nach einigen Seideln echter »Provinz«. Und wird unversehens zum Republikflüchtling, einer zu Zeiten des Realsozialismus in unseren Breiten hoch geachteten, inzwischen leider fast vergessenen Spezies.
Die Unabhängigkeit, auf die Michael Stolhofer pocht, „besteht darin, möglichst viele Partner zu finden, die sich an den Kosten beteiligen.“ Die Verbindung von Kunst und Kommerz sei „ein notwendiges Überlebensmodell für die Kunst“. Das klingt nach der in den letzten Jahren forcierten Eventkultur. Image- und Werbestrategien ersetzen oft genug die künstlerische Potenz, und einmal mehr beschleicht den staatenlosen Weltbürger das Gefühl, dass es sich bei dieser Republik um einen groß angelegten Etikettenschwindel handelt.