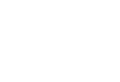Von der Abschaffung der Kunst in Salzburg
Vor ein paar Jahren war ich in New York und wollte der Pflicht des aufgeklärten Weltbürgers Genüge tun, indem ich endlich das Guggenheim-Museum besuchte. Beim Eintreten stellte ich fest, dass dort nur Motorräder ausgestellt waren. Schau' mal an, dachte ich, sogar das Guggenheim-Museum ist also in Geldnöten und muss sein Stammhaus für kommerzielle Veranstaltungen vermieten! Weil ich schon da war, ging ich durch die prächtigen Räumlichkeiten und gab mir Mühe, die Harley-Davidson, die dort glänzten, interessant zu finden. Es gelang mir nicht, weil ich die motorisierte Fortbewegung zwar für durchaus nützlich halte, aber ihr keinen höheren moralischen Wert zumesse. Erst nach einiger Zeit lehrte mich das Verhalten der anderen Leute, die durch die hübsche Ausstellung zogen, dass Guggenheim dieser nicht aus finanziellen Gründen Namen und Logis zur Verfügung gestellt, sondern sie vielmehr aus Eigenem organisiert und gestaltet hatte. Die blitzenden Motorräder waren also Museumsstücke, und da Guggenheim sein Renommee nicht daraus bezieht, die Archäologie des Alltags zu erforschen, sondern weltweit einen bestimmten Standard von moderner Kunst zu etablieren, wurden die Motorräder offenbar als Objekte zeitgenössischer Kunst präsentiert.
Seit damals habe ich mir ein bisschen genauer angesehen, was in den diversen Guggenheim-Museen der Welt so ausgestellt wird, und etwas Verblüffendes bemerkt: Überall, wo sich dieser Museumstrust hineingesetzt hat, werden bald die führenden Modeschöpfer, ob sie Armani oder Versace heißen, mit Personalausstellungen gewürdigt. Wir haben es bei McGuggenheim also mit einer Unternehmung zu tun, die den Kommerz mit dem Status von Kunst versieht und uns zeigt, dass es von der Shopping-Mall zum Museum nur ein kleiner Schritt ist. Ein kleiner, aber ein wichtiger, denn er zerstört immerhin, was über ein paar lächerliche Jahrhunderte die Würde, Bedeutung, ja die Notwendigkeit von Kunst ausgemacht hat: dass sie zu dem, was herrscht, im Widerspruch steht, und der Welt, wie sie ist, eine andere, eigene Welt entgegenstellt.
Damit ist es inzwischen vorbei. Das alte Museum sei eine abgelebte, in bildungsbürgerlicher Fadesse entschlafene Sache, wird uns gelehrt, jetzt endlich gebe es die Idee, nein: das Konzept eines Neuen Museums, das seine Tore geöffnet habe, damit frische Zugluft durch die modrigen Gänge ziehe. Man muss verstehen, in einer Zeit, da sogar die Hersteller von Schuhen ihre Produkte mit dem Versprechen zu verkaufen suchen, diese würden eine »Revolution des Gehens« bewirken; in einer Ära, in der sich selbst konservative Politiker nicht mehr als langweilige Garanten des Bestehenden, sondern als Motoren der Veränderung bewerben müssen; kurz, in einer Ära, da der Stillstand kollabiert und sich als rasenden Fortschritt ausgibt, ist es unausweichlich, dass die vollständige Kommerzialisierung der Kultur sich als revolutionären Aufbruch darbietet; und folglich den Applaus aller Geister und Gespenster des Fortschritts findet.
Was für ein Aufbruch ist das? Bricht in den Museen die Demokratie aus, wenn sie zu Werbeflächen für führende Marken von Bekleidung und Design verkommen? Ist es ein politischer, sozialer, kultureller Fortschritt, wenn der Propaganda für die Verhältnisse, wie sie sind, die Aura von Kunst verliehen wird? Nein, was heute geschieht, das ist nicht die Öffnung der Museen, sondern die Sakralisierung des Kommerzes mittels der Museen. Indem Design, Modefotografie, Luxusartikel museumswürdig werden, wird die neoliberale Religion, dass Reichtum der höchste Wert sei, aus dem Bereich des schnöden Profits in die hehre Sphäre der Ästhetik geholt. Das Dogma, dem wir uns fügen sollen, lautet: Wer konsumiert, ist kulturell tätig, ja erst indem wir die Ikonen des Konsumismus anstaunen, werden wir zu Kulturmenschen. Das Museum selbst hat es uns zu weisen: es gibt sie noch, die sakralen Gegenstände, würdig unserer Anbetung – es sind die schönen Waren, Motorräder, Markenhosen, Designerzeug; sie zu verehren, ist keine triviale Sache, sondern eine kulturelle Leistung, sie in Besitz zu nehmen eine religiöse Handlung. Guggenheim ist die trade-mark für diese Sakralisierung, und daher scheint es überfällig, dass auch Salzburg endlich eine solche Kathedrale erhält, in der das Hochamt des Konsumismus zelebriert wird, gleich ob am Berg oder im Berg, jedenfalls in den Niederungen jener Kultur, die aus Kunst Propaganda, aus Kritik gute Laune und aus einer Stadt eine Bühne für Events macht.
Doch halt, haben wir nicht bereits genügend Kirchen, in denen diese Lehre verkündet wird? Da gibt es doch, beispielsweise, unser Rupertinum! Was sehen wir in diesem Museum, außer dass wir dort neuerdings all die Burschi von Blasenstein und Mucki von und zu Tittenhausen sehen können, die sich bei den Vernissagen treffen? Nun, wir sehen Modefotografie. Helmut Newton ist gewiss ein guter Modefotograf, denn es ist wirklich nicht mehr leicht, Nackerte noch so zu fotografieren, dass sie unter den Tonnagen von Fleisch, das täglich abgebildet wird, als die Nackerten eines bestimmten Fotografen wiedererkannt werden können. Newtons erotische Kühlschrankfantasien sind wiedererkennbar, und deswegen soll man ihm Ruhm und Vermögen eines Weltstars der Modefotografie nicht neiden. Noch vor fünfzehn Jahren war Newton damit auch völlig zufrieden, und wenn ihm damals jemand mit der Idee gekommen wäre, ihn, den Werbefotografen, zum Künstler zu adeln und in einem honorablen Museum auszustellen, hätte er ihn ausgelacht. Aber in den letzten fünfzehn Jahren ist viel geschehen, nicht mit Newton, sondern in der kulturindustriellen Gesellschaft. Im Triumph des Konsumismus ist die Reklame zur Kunst geworden, sodass nunmehr von der öffentlichen Hand subventioniert wird, was eigentlich zur Steigerung privaten Gewinnes erfunden wurde, und im Museum hängt, was als Werbung gedacht war. Kurz, mit dem Rupertinum gibt es in der Altstadt bereits einen großen Veranstaltungsraum, in dem diese Eucharistie, welche Reklame in Kunst und umgekehrt Kritik in Zustimmung verwandelt, gefeiert wird. Warum dann noch mehr, noch größere solcher Stätten? Weil es keine Götter außer dem einen mehr geben soll, der die Gläubigen zu einer gutgelaunten, weltoffenen Gemeinde schart, die unterhalten werden will.
Da Salzburg aber eine kleine, verkehrte Welt für sich ist, wird die Globalisierung kulturellen Fastfoods übrigens besonders leidenschaftlich von jenen gefordert, die eigentlich ihre natürlichen Gegner sein müssten, von den Grünen und den Sozialdemokraten; das hat allerdings Methode, denn die Kunst wird hierorts überhaupt häufig von jenen in Bedrängnis gebracht, die sie eigentlich zu unterstützen, hüten, verbreiten hätten. Das Landestheater, im Stich gelassen von seinen Subventionsgebern, hat in den letzten Jahren beispielsweise von sich aus die Versteigerung von Sportwagen auf seiner Bühne nicht nur zugelassen, sondern diese sogar unmittelbar in eine Ballettaufführung integriert; und großartige Einfälle wie den gehabt, den Sieger der Fernsehstaffel von »Taxi Orange« als Schausteller seiner selbst zu engagieren und so gratis Reklame für das Fernsehen in seiner schlechtesten Form zu machen, ohne auch nur einen einzigen, der süchtig nach Reality-TV ist, für das Theater zu gewinnen...
Im Salzburger Literaturhaus wiederum ist im Frühjahr ein Mann zu Gast gewesen, den man getrost als Analphabeten bezeichnen kann. Stuckrad von Barre heißt das allezeit witzige Bürschchen, das zwar nicht schreiben kann, das aber gerne vor kreischenden Teenagern unter Beweis stellt. Als Oberhaupt der leicht neurasthenischen Gruppe von deutschen Popliteraten, die mit ihren spießigen Exaltationen einiges Aufsehen um sich machen, ist er auch durch Österreich getourt und nach Salzburg gekommen. Daran ist nichts Schlechtes, und wenn er in einer Discothek sein Publikum auf die ihm gemäße Weise unterhalten hätte, wäre auch gar nichts dagegen zu sagen gewesen. Aber nein, der Bursche, der sich über jedwede Form von Literatur, die diesen Namen verdient, mit dem brachialen Humor des Talkmasters und Quotensiegers hermacht, musste bei uns natürlich unbedingt im Literaturhaus auftreten; im Herbst vergangenen Jahres hatten dessen Verantwortliche noch vehement dagegen protestiert, dass Bertl Göttl die Buchwoche eröffnet — im Frühjahr hingegen waren sie glücklich, Stuckrad von Barre, den man als globalisierten Bertl Göttl, als Spießer auf der Höhe der Zeit verstehen muss, in ihre Räumlichkeiten zu bitten. So viel ich weiß, haben sie immerhin nachträglich begriffen, dass solche »Öffnung« nichts anderes als eine Probe auf die Selbstabschaffung der Literatur wie des Literaturhauses war.
Der schwindenden gesellschaftlichen Bedeutung von Literatur kann man nämlich nicht trotzen, indem man auf den Analphabeten als Hoffnungsträger setzt. Und das Theater wird nicht überleben, wenn es sich dem Fernsehen beflissen als Marketing-Unternehmen andient. Zwar kann man am Kunstmarkt eine Zeitlang mit der Abschaffung der Kunst gut verdienen, aber wenn im Museum die Reklame für Kunst gilt, dann wird es bald so sein, dass umgekehrt die Kunst nur mehr als Reklame taugt. Auffällig, daß zwar über die Frage, wo das Museum nun eigentlich stehen soll, in Salzburg heftig debattiert wird, aber offenbar völlige Einigkeit darüber besteht, dass es keine Stätte der Kunst und der Auseinandersetzung mit ihr sein soll, sondern etwas ganz anderes: eine Art Messehalle, in der sich die ökonomische Macht selber feiert, indem sie das, womit sie ihre Geschäfte macht, auch als das ästhetisch Wertvolle inthronisiert. In großen Inseratenkampagnen wird derzeit für ein Museum im Berg geworben; aber die wahre Forderung, die hinter diesem Wunsch nach einem Museum im Berg steckt, wird leider nicht ausgesprochen. Darum sei sie hier ergänzend angefügt: Auch wir wollen endlich Motorräder sehen!