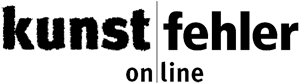Keine Gnade für Dumpfbacken!
Über die Notwendigkeit von Satire und Polemik. Und was der Spaß kosten kann. Am Beispiel der Hochhumorzentralorgane PARDON und TITANIC.
Der geniale Dichter und Maler Robert Gernhardt hat den Nagel auf den Kopf getroffen: »Alle Komik will dasselbe: Lachen machen. Jedes Lachen ist Verlust an Kontrolle.« Der Kontrollverlust entsteht aber nur, wenn Konventionen und geläufige Erwartungen aufgebaut werden, die dann in der Pointe zusammenbrechen. Lachen ist die Befreiung und Zerstörung von Normen und Konventionen. Lachen ist Anarchie, die pure Subversion. Und so ganz nebenbei noch gesund. So viel zur Theorie. In der Praxis vergeht einem bisweilen schon mal das Lachen über die politische Lage: Zu gleichen Teilen Schmierenkomödie und Trauerspiel, nur mit einer gehörigen Portion Galgenhumor zu ertragen. In diesen Tagen sorgt ein Teil der Staatselite für eine Realsatire von dubioser Qualität. Nur unfreiwillig komische Zeitschriften kommentieren das Elend und diese können keine »Linderung« verschaffen. Da bleibt nur ein Blick ins Ausland. Genauer ins »Deutsche Reich«, wo die Spitzenprodukte deutschsprachiger Humorproduktion beheimatet waren und noch immer sind. Ausgerechnet die Bankenstadt Frankfurt muss als Witzzentrum der gern als humorlos gescholtenen Germanen gelten. Mit zwei Beinahe-Jubiläen wollen wir den nötigen Respekt erweisen.
Alles begann vor fast 40 Jahren, 1961, als der Verleger Hans A. Nikel mit der monatlich erscheinenden Zeitschrift »Pardon«, die Komik auf eine neue Umlaufbahn katapultierte. Nicht nur Gesellschaft und Politik, sondern auch der Humor war in den Wirtschaftswunderzeiten ausschließlich bieder und altbacken. Mit »Pardon« änderte sich die Szene schlagartig. »Lustiger, besser ausgeschlafen und informiert, origineller und heller«, so charakterisert Titanic-Autor Gerhard Henschel das Satiremagazin. Besonders einmalig war die Beilage »Welt im Spiegel« (WimS), die vom eingangs zitierten Gernhardt, F.W. Bernstein und Friedrich Karl Waechter 1964 bis 1976 in wahrer Gemeinschaftsarbeit gestaltet wurde. Eine bis heute zu den Humor-Klassikern in der Literatur zählende wilde und respektlose Mischung aus komischer Kurzprosa, lustiger Lyrik, Bildergeschichten, Fotoromanen, Nonsens und Cartoons war das Ergebnis. Seine Effekte bezog die Kolumne aus einer damals ganz neuen Konfrontation von Bild - Foto oder Zeichnung - und Text. Stete Inspiration und Reibungsflächen boten den Autoren »Presse, Provinz, Werbung und Wahnsinn«, diese »unheilige Allianz, die ðWimSÐ erst möglich machte«, so Gernhardt 1978. Vorbilder für »Pardon« kamen aus den USA: Comics und die Zeitschrift New Yorker. Die Abnabelung vom Kabarett war vollzogen. Eher goutierten die Macher, zu denen bisweilen auch zahlreiche (spätere) Schwergewichte des deutschen Journalismus wie Erich Kuby, Günter Wallraff und Alice Schwarzer zählten, die dadaistischen Aktionismen der Spaßguerilla. Immerhin verkaufte »Pardon« in seinen besten Zeiten 300.000 Exemplare. In den späten 70ern wurde Verleger Nikel aber selbst zum Fall für seine Autoren. Er hatte sich zu einem unerträglichen autoritären Gebieter mit allerlei spinnerten esoterischen Anwandlungen entwickelt. Als Folge stiegen seine besten Humoristen aus und gründeten »Titanic«, zuerst drei Jahre lang Konkurrenz- und dann Nachfolgeorgan von »Pardon«. Die Spaßlaberln machten Ernst und installierten ein Gesellschaftermodell mit Sperrminorität. Unabhängigkeit als stilistischer und zeitungspolitischer Grundsatz war oberstes Gebot.
Das erste Heft des »endgültigen Satiremagazins«, so der Untertitel, erschien im November 1979. Seitdem hält der Terror an. Schreibstile und Textsorten, die in anderen Presseprodukten nicht oder kaum gepflegt werden (können?), bestimmen das Zentralorgan der »Neuen Frankfurter Schule« für Provokation und guten Geschmack. Radikale, schonungslose Polemik, Attacken, Invektive - also kurze, sehr schneidende Schmähkritiken ohne Begründung - , humoristische Glossen und Kolumnen, (Anzeigen-)Parodien, Bildgeschichten, Fotoromane, Grotesken, reichlich Nonsens und natürlich klassische Satiren. Oder wie es Chefredakteur Oliver M. Schmitt gewohnt treffsicher formuliert: »Engagierte Revolverjournalismus auf höchstem ethischen Niveau«. Die Anbindung an gesellschaftliche und politische Ereignisse verlieren die Witzguerilleros nie. Durch aufmerksames Studium der Medien kommt keine mehr oder weniger öffentlich geäußerte Dummheit oder Frechheit unkommentiert davon. Ihre Verursacher werden gnadenlos abgewatscht. Von den bislang über 240 erschienenen Ausgaben wurden fast 30 verboten oder durften nicht mehr ausgeliefert werden. In zahllosen Prozessen ging es um Unterlassungserklärungen und Schmerzensgeldforderungen. Den fragwürdigen ersten Platz in der »beleidigten Leberwurst-Wertung« erstritt sich vor Gericht der damalige SPD-Vorsitzende Björn Engholm. Grund: eine satirische Fotomontage auf dem Cover des Heftes 4/1993. Dort wurde Uwe Barschels - er war der politische Konkurrent Engholms - Selbstmord in einer Badewanne eines Genfer Hotels nachgestellt, bloß mit einem lächelnden Engholm in der Wanne und der Bildlegende: »Sehr komisch, Herr Engholm!« Verurteilt wurden die gnadenlosen Witzbolde wegen weiterer Collagen im Heftinneren der nächsten Ausgabe, in der gleich noch »nachgelegt« worden war. Zu DM40.000.-, dem bislang höchsten Schmerzensgeld in der deutschen Pressegeschichte, plus den Gerichtskosten, insgesamt fast DM 200.000.- Zwei Tatsachen zum besseren Verständnis dieses Urteils: Erstens kam die Klage des SPD-Politikers überraschend. Der damalige Bundeskanzler und inzwischen überführte Megagauner Kohl (den im Übrigen die »Titanic«-Redakteure zur »Birne« krönten) und andere konservativ-reaktionäre Würdenträger waren zuvor noch heftiger attackiert worden. Manche Hefte wurden zwar beschlagnahmt, auf eine Klage war aber wohlweislich verzichtet worden. Offensichtlich um weitere Publicity für »Titanic«, dessen Auflage seit Jahren bei etwa 60.000 steht, zu vermeiden. Zweitens versuchte Engholm - letztlich vergebens - nur von seiner eigenen Verstrickung in die Barschel-Affäre abzulenken. Gerichtliche Satisfaktion suchten noch zahlreiche andere Privatpersonen (Kulenkampff...), Firmen (McDonald`s...), Institutionen (Bundeswehr, Kirche...).
Obwohl tumbe Blödel-Comedys derzeit in den unzähligen TV-Sendern Konjunktur haben, stehen die Chancen für im weitesten Sinne politische Satiriker nicht sehr gut. An allen Ecken lauern Prozeßhanseln. Für Autoren, die ohnedies zwischen allen Stühlen sitzen, da ihre Texte nicht so recht in die Medienlandschaft hineinpassen, irgendwo zwischen journalistischen Kolumnen und literarischen Miniaturen pendeln, bedeutet diese (Existenz)Bedrohung oft eine Form von Vorzensur. Auch Kleinverlage sind wirtschaftlich schnell erledigt. An Tabuverletzungen, wie sie nun einmal bei Satire und Polemik nötig sind, hätte gerade Österreich starken Nachholbedarf.
Buchtip: Peter Knorr/Hans Zippert (Hrsg.): "Das Beste aus 20 Jahren Titanic" (Elefanten Press 1999)