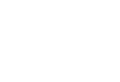»Die größte Perversion ist, daß man von allem den Preis kennt und von und nichts den Wert«.
Gerard Mortier, Intendant der Salzburger Festspiele, über Richard Strauß & Zillertaler Schürzenjäger, Lulu & Helga Rabl-Stadler
Sie sind Anfang April mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern nach Italien gefahren, um die Ursprünge des neuzeitlichen Theaters zu ergründen und auf den Spuren Verdis zu wandeln. Was ist Ihr besonderes Anliegen bei einer solchen Arbeit mit Jugendlichen?
• Ich glaube, daß das Theater für die heutige Jugend noch eine ungeheuere Rolle spielen kann. Nur haben sich diese Theaterformen zur Zeit manchmal zurückgezogen in zu elitäre Gebäude, um die Jugend zu erreichen. Um sie einzuführen in das Theater muß man diese erste Angst nehmen, so ein Theater zu betreten. Ich bin sicher, daß diese Leute, die jetzt mit waren, auf alle Fälle keine Angst mehr haben werden, in diese Theater zu gehen. Ob sie dann hineingehen, das ist deren Sache, ich möchte sie auch gar nicht hineinzwingen, weil dieses Theater wird sie schon hineinlocken, wenn dieses Theater über ihre Zeit redet. Das große Problem der heutigen Zeit ist, daß wir fast nur noch Theater spielen und Aufführungen bringen über eine vergangene Zeit. Das wäre nicht so schlimm, wenn wir wenigstens andeuten, daß das, was in einer vergangenen Zeit passierte, auch heute noch gültig ist.
Jüngere Generationen haben ja einfach andere kulturelle Codes, die sich sehr unterscheiden von jenen der Oper. Wenn man sie jetzt einführt in die Oper, bleiben da nicht nur kulinarisch aufgearbeitete Allgemeinplätze? Besteht die Möglichkeit, daß Theater oder Oper für sie ein wirklich elementares Erlebnis ist?
• Im großen Theater, ob das nun Mozart, Shakespeare oder einige Werke von Verdi sind, da geht es wirklich an die Existenz. Es ist mein großer Versuch - und ich weiß nicht, ob mir das gelingt -, junge Leute mit irgendeiner Geschichte gefangen zu nehmen, sodaß sie auf einmal spüren, es geht um die eigene Existenz. Sie spüren das viel mehr bei den Formen der eigenen Zeit - bei einem Rocksänger, bei bestimmten Liedern. Es fasziniert mich immer wieder, daß ein bestimmter Popsong so faszinieren kann. Wenn ich das besser verstehe, kann ich vielleicht herausfinden, was ich erzählen muß mit dem Theater, was dessen eigentliche Probleme sind. Nur eins kann ich nicht tun: Es simpel machen für sie. Alle große Kunst stellt Anforderungen, die verkauft sich nicht wie eine Hure.
Wie ist es nun für Sie persönlich in Ihrer Arbeit: Wie können Sie in Ihrer Position verhindern, daß Sie bloß Sachverwalter von Kultur sind, sondern wirklich lebendige Inhalte transportieren?
• Hier gehen Sie zum Kern zur Sache. Ich muß einerseits dafür Sorge tragen, daß diese früheren Kunstformen noch etwas sagen, daß es keine geschlossenen Kunstwerke sind sondern offene, die eine Kommunikation haben. Andererseits muß ich kämpfen gegen den Kleinbürger, der sich diese Kunstwerke aneignet und sich aus diesen Kunstwerken nur das herausholen will, was ihm paßt.
Und da ist auch das große Problem, kritisch zu sein mit meiner Liebe zur Oper. Ist es nicht, weil sie mich bestätigt in bestimmten bürgerlichen Gefühlen? Ist es nicht das, daß ich mich repräsentieren will?
Wir haben zwar seit den siebziger Jahren eine neue, unglaubliche Steigerung der Opernaufführungen, aber gleichzeitig den Niedergang der Oper als einer kreativen Kunstform. Da würde ich sogar als Opernliebhaber sagen, daß ich manchmal den Eindruck habe, daß der Film viel besser über meine Zeit erzählen kann als die Oper.
Hat es da noch Sinn, daß ich eine neue Oper beauftrage, und was soll diese neue Oper sein? Da gibt es eine neue Initiative: Ich habe den Filmemacher Hal Harkley gebeten, ein Skript für eine neue Oper zu schreiben. Wir werden schauen, daß es so eine Art Rockoper gibt - sagen wir einmal: Mit den Mitteln der Rock- und Popmusik.
Bringen Stargagen und teure Ausstattungen nicht auch einen Konkurrenzkampf mit sich, der so weit geht, daß sich immer weniger Häuser Opernaufführungen leisten können?
• Man muß sich ja nicht Stars leisten, man muß sich nur gute Aufführungen leisten. Ich kämpfe gegen zu teure Ausstattungen und gegen zu teure Sänger, aber was ein Sänger verdient, ist ja lächerlich wenig dagegen, was ein Tennisspieler verdient. Wenn aber der Tennisspieler mehr verdient in dieser Welt, dann deshalb, weil das große Publikum Wimbledon wichtiger findet als die Oper. Man fängt nur dann über Geld zu sprechen an, wenn man etwas nicht mehr für wertvoll hält. Und daß Pavarotti der teuerste Sänger ist, heißt nicht, daß er der beste ist. Nur, viele Leute mögen die Oper als Unterhaltung, und der Pavarotti ist für viele Sechzigjährigen, was Michael Jackson vor zehn Jahren für Fünfzehnjährige war. Die Oper wird nicht zugrundegehen am Geld, sie wird zugrundegehen, wenn sie sich selbst nicht mehr vermittelt, wenn sie nichts mehr aussagt.
Wenn Sie sagen, daß Kunst nicht durch Geld bemessen werden kann, wie geht es Ihnen dann damit, wenn bei Peter Stein diese Diskussion um Geld von der anderen Seite, aus den eigenen Reihen kommt?
• Daß diese Diskussionen auftauchen, ist normal. Wenn sie das wichtigste Element werden in der Diskussion um die Festspiele, ist es falsch. Bei Stein ist es meinem Gefühl nach sicher falsch. Wenn man auf einmal den Eindruck hat, daß es ohne dieses Geld nicht geht, kann das nicht stimmen. Es ist aber klar, daß bestimmte Erneuerungen nur dann existieren können, wenn Geld investiert wird. Wenn Produktionen sich selbst tragen, ist es ja schön, aber es spricht nicht für sich, soll nicht ein Wert an sich sein. Rentabilität soll nicht der höchste Verdienst der Festspiele sein. Die größte Perversion ist ja, daß man von alles den Preis kennt und von nichts den Wert. Und das habe ich auch kürzlich dem Rechnungshof gesagt (lacht).
Wie sieht nun Ihre persönliche Perspektive aus, was die Festspiele in Salzburg und auch für Salzburg sein könnten? Diese Perspektive scheint für Sie auf jeden Fall mit großen Zweifeln verbunden zu sein.
• Ich selbst stehe vor einer Verhandlung über die Verlängerung meines Vertrages und habe gleichzeitig sehr große Zweifel. Ich habe jetzt auch ein Jahr gewartet, ob ich überhaupt jemanden entdecke bei der Presse, der eigentlich die zwei Schlüsselstücke sieht in meiner (heurigen; Anm.) Programmgestaltung. Es ist gesagt worden: Mortier setzt den Schwerpunkt Frau undsoweiter... Das war nicht der Schlüsselgedanke. Die eigentliche Schlüsselidee des diesjährigen Sommers, was keiner bemerkt hat und was für mich doch darauf hinweist, daß wenige überhaupt nachdenken über die Festspiele, sind für mich die Stücke Rosenkavalier und Lulu.
Meine Aufgabe, als ich 1992 angetreten bin, war eigentlich, die Festspiele erst einmal wieder dahin zu bringen, wo sie entstanden sind - im Geiste Hofmannsthals.
Der Rosenkavalier drückt eigentlich eine Gesellschaft der nicht erfüllten Sehnsüchte aus, was auch Herbert Wernicke ganz toll sagt und auch inszenieren wird. Und diese Sehnsüchte verbinden mit dem Barock, dem Barock als - nicht zu vergessen - einem Symbol der Gegenreformation; ich bin ja Jesuitenschüler, ich muß es also wissen. Ich fand den Rosenkavalier deshalb unglaublich wichtig, weil das Stück für mich das symbolisiert, was sie (die Gründer der Festspiele; Anm.) eigentlich wollten. Diese Ursprungsidee ist leider eine sehr konservative. Auch von Anfang an waren die Preise so hoch angesetzt, daß nur ein bestimmtes Publikum hinkonnte.
Zum 75jährigen Bestehen der Festspiele möchte ich die Alternative zu diesen konservativen Gedanken entwickeln, und das ist die Lulu. Die Alternative zu Hoffmansthal und Richard Strauß war ein Wedekind, Karl Kraus, Schönberg, die Wiener Schule. Mein großer Zweifel ist, ob Organisation, Subvention, Kartenpreise, Publikum - ob diese Strukturen es mir möglich machen werden, diese Linie weiterzuführen.
Es ist natürlich so, daß zu jenen Publikumsschichten, die gleichsam ein Nährboden wären für solche Reformen, gewisse historische Klüfte zu den Festspielen bestehen.
• Ich habe noch nicht genau definieren können, was eigentlich der Nährboden ist in Salzburg. Was ich lediglich feststelle, ist ein Kulturverein mit einem sehr kleinbürgerlichen Publikum (Verein der Freunde der Festspiele; Anm.), der in seinem ganzen Konzertprogramm einen bürgerlichen Geschmack des 19. Jahrhunderts unterstützt. Dieses Publikum werde ich komischerweise am schwersten für die Reformpolitik der Festspiele gewinnen. Ich glaube, ich muß in der Programmgestaltung erst versuchen, mein Programm auf einer internationalen Plattform vorzustellen, damit da ein Publikum kommt, das sich neu zusammenstellt. Inwieweit das schon geschehen ist, kann man nicht so präzise beurteilen, sicher ist jedoch, daß schon 25% des Publikums wirklich ausgetauscht ist und daß die Sommerfestspiele gegen-über den Osterfestspielen jetzt als großes Avantgardefestival dastehen, was ja ein bißchen lächerlich anmutet, wenn man sieht, was wir spielen, aber das sagt viel aus.
Aber es wäre natürlich schön, wenn diese Richtung der Salzburger Festspiele getragen würde von einem bestimmten Publikum in der Stadt Salzburg. Doch das bürgerliche Publikum der Stadt Salzburg will ja diese Neuerrichtung nicht. Für diese Leute sollten die Festspiele das Gleiche sein, was sie das ganze Jahr sehen, aber möglichst mit Leuten, die das alles auf Schallplatte bespielen. Dieses Publikum ist es auch, das die Generalproben - teilweise - füllt, was ein großes Problem für mich ist. Wenn diese Karten mehr zu Alternativgruppen gelangen würden, würde das schon viel ändern. Die Leute, denen ich jetzt die Generalprobe von Lulu zeige, möchten zum Teil die Lulu gar nicht sehen, während viele Leute in Salzburg gerade diese Lulu sehen möchten. Aber da gibt es Privilegien und festgerostete Traditionen, nach denen die Generalprobenkarten so verteilt werden, daß sie gerade zu den bürgerlich-konservativen Kulturvereinen gelangen. Daher muß ich für die Generalproben unbedingt eine total neue Lösung finden.
Wie geht es Ihnen bei der Konfrontation zwischen Jedermann und Zillertaler Schürzenjägern?
• Ich muß Ihnen eine komische Geschichte erzählen: Ich lief über die Straße, und ein Fernsehteam kommt auf mich zu und fragt mich, was ich zu den Zillertaler Schürzenjägern meinen würde. Ich muß bekennen, daß ich überhaupt nicht wußte, wer das war, und meine Reaktion ist sehr einfach gewesen: Für mich kann auf dem Residenzplatz jede Form von Musik stattfinden, wenn es gute Musik ist. Inzwischen wußte ich, daß wir am gleichen Tag eine Probe hatten, die nicht länger dauerte als bis acht Uhr, und daß wir schwer auf diese Probe verzichten konnten.
Da kommt der Bürger dieser Stadt und sagt: Wir wollen zwar die Schürzenjäger, aber zu einem Zeitpunkt, wo wir noch rechtzeitig schlafen gehen können. Ein echter demokratischer Bürger Salzburgs würde sagen, wir wollen den Jedermann im Sommer, da gibt es eine wichtige Schlußprobe, die lassen wir stattfinden, und dann machen wir dieses Konzert. Aber diese Demokratie gibt es hier nicht. Es wird immer gegeneinander ausgespielt.
Wie geht es Ihnen nach vier Monaten mit Helga Rabl-Stadler?
• Ich kann Ihnen dazu nur sagen: Wir versuchen uns zusammenzuraufen. Was mich fasziniert und mir Freude macht, wenn ich spüre, daß jemand, der wirklich zu dieser konservativen, katholischen Ordnung gehört, daß diese Dame, die mich das eine oder andere Mal sehr angegriffen hat, eigentlich in der Arbeit entdeckt, daß der Weg, den wir gehen, vielleicht nicht so der schlechteste ist, und sich eigentlich sogar bemüht, meine Gedanken zu verstehen. Das war am Anfang sehr schwierig, für mich fast unmöglich, aber es lohnt sich immer wieder, sich auseinanderzusetzen. Jetzt werden wir mal sehen, was die Zukunft bringt, aber ich habe den Eindruck, daß sich Helga Rabl-Stadler zu einer sehr progressiven Dame entwickeln wird.
Welche Bedeutung hat eigentlich Ihre Position für Sie?
• Ich hänge zwar sehr an meiner Arbeit, aber nie an meiner Position. Wo ich die Position habe, um diese Arbeit durchzuführen, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Das kann Salzburg sein, das kann irgendwo anders sein.
Das Gespräch führte
Mario Jandrokovic
»Ich wohne halt in dieser Stadt und zahle meine Steuer hier, bin daher sehr demokratisch im Vergleich zum Vorgänger von mir, und ich will auch etwas sagen können dafür.
(Mortier über Steuer, Demokratie und Karajan)
»Am Anfang des 20. Jahrhunderts ist es dann so gewesen, daß der reiche Bürger nicht mehr nur in die Oper ging sondern auch ins Moulin Rouge, weil der Tanz dort ein bißchen extra-vaganter war.«
(Mortier über Kunst und Genuß)