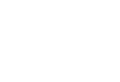»So will ich nicht mehr«
Claus Tröger, Intendant des Kleinen Theaters, geht. Dem »kunstfehler« schildert er seine Gründe
Es passiert selten, daß der Leiter einer Salzburger Kulturinstitution abtritt.
• Kürzlich war ich in der Schweiz und hab dort einen sehr guten Freund getroffen, der ein Theater in der Größenordnung des Kleinen Theaters leitet. Er ist gleich alt wie ich, und ich weiß, daß er in 30 Jahren die gleichen Probleme wie jetzt haben wird. Er wird keinen Schritt vorwärts gekommen sein, er wird den Status quo maximal gehalten haben. Das ist eine Ausgangssituation für sehr viele, wenn nicht alle Kultuschaffenden in unserer Liga. Ich glaube, das kann nicht das Ziel sein.
Wenn man seine Arbeit immer daran mißt, wie die Subventionen sind, dann bedarf es eines Revidierens, das mit einem qualitativen Ziel, das man in der Kunst und der Kulturarbeit haben muß, nichts mehr zu tun hat. Hier beginnen meine Schwierigkeiten. Ich müßte künftig - vom status quo ausgehend - viel zu oft mein künstlerisches Ziel, die Qualität, die ich erreichen möchte, revidieren.
Du willst dich also mit den Rahmenbedingungen nicht länger herumschlagen?
• Ich will mit dieser Position »Bittsteller« einfach nicht mehr umgehen. Ich finde, daß Subventionen Investitionen der öffentlichen Hand in ein Kulturangebot sind. Investition in Salzburg für Salzburg, in Zuschauer, in Steuerzahler, auch in Umwegrentabilität. Das sind die wesentlichen Faktoren. Aber nicht, daß man sagt, die Theater brauchen so viel. Das stimmt ja nicht.
Hat dich also die Zermürbungstaktik der Stadtpolitik zu dieser Konsequenz geführt?
• Nicht ausschließlich. Das Problem ist, wie Körperschaften, wie Kulturpolitiker mit dieser Kultur umgehen. Wenn wir aus der Notsituation heraus mit weniger Subvention umgehen müssen und auch immer wieder können, dann ist die nächste Konsequenz die, daß es heißt, es geht eh mit weniger auch.
Eigentlich müßte eine Körperschaft hergehen und sagen: Das wollen wir, und das wollen wir nicht. Und wenn wir das wollen, dann diskutieren wir nicht mehr darüber, sprich dann akzeptieren wir dieses Angebot. Nicht, weil es eine Investition in diesen Kulturbetrieb ist, sondern, und das ist mir ganz, ganz wichtig, daß es eine Investition in ein Angebot ist. Das vom Publikum ja auch angenommen wird!
Ich meine damit nicht nur das Kleine Theater, sondern es geht um alle Kulturinstitutionen, die seit vielen Jahren zu kämpfen haben.
Was ist bei dir geschehen, daß Du daraus die Konsequenz des Abgangs
ziehst? Andere in vergleichbaren Positionen, die das auch durchschaut und die selben Probleme haben, ziehen sie nicht.
• Vielleicht hängt das mit diesem Schweizer Kollegen zusammen. Daß man irgendwann einmal hergeht und sagt: Ich muß das akzeptieren, was soll ich sonst machen. Der Widerstand, den ich leiste, ist, daß ich vielleicht ab und zu den Mund aufmache. Dann höre ich wieder, daß ich ihn ja gar nicht aufmachen darf, weil ich ja Subventionsempfänger bin. Ich möchte mich nicht damit abfinden. Ich müßte meine Ziele revidieren und das mache ich nicht mehr!
Es ist eine grundsätzliche Einstellung: Wie geh ich mit dem um, was ich erreicht habe? Wie geh ich mit dem Status quo um, und wie mit der Zukunft? Es gibt nur zwei Varianten: entweder alt zu werden und den Status quo zu halten, ja nicht schlechter zu werden, oder aber klare Ziele zu haben und zu sagen, es gab eine Entwicklung, es gibt eine Nachfrage beim Publikum, und diese Nachfrage bedarf auch einer Weiterentwicklung im Theater. Und die muß man zulassen.
Und fördern. Was sagt dir dein Gefühl: Wie wirst du in zwei Jahren über diese Entscheidung denken?
• Der Entscheidungsprozeß dauert schon lange. Zum ersten Mal hab ich darüber nachgedacht bei den Fördergesprächen vor einem Jahr, als Reduzierungen angesagt wurden und ich eine Betriebsversammlung einberufen und gesagt habe: Herrschaften, es schaut effektiv so aus, daß nach den 8.000 unbezahlten Überstunden heuer im nächsten Jahr 16.000 anfallen können. Seid ihr bereit, da mitzumachen oder sagen wir: Unsere Grenze ist erreicht, wir hören auf?
Ich hab gleich deponiert, daß ich akzeptiere, wenn es heißt, wir hören auf. Die Mehrheit war der Meinung, wir tauchen da durch, schlechter kann es schließlich nicht mehr werden, es kann nur besser werden. Das war damals der erste Anlaß, darüber nachzudenken. Ich hab meine Bedenken aber vom Tisch gewischt, weil es so viele Aufgaben gab, die ich noch machen wollte und in denen ich einen Sinn sah - etwa diese Spielstätte hier im Nonntal.
Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem ich mir sage, es wird nicht positiv weitergehen. Ich hab eine Entwicklung durchgemacht, die mich an einen Punkt gebracht hat, der mir bis jetzt in allen meinen Entscheidungen am schwersten gefallen ist. Aber ich weiß: Auch in zwei Jahren steh ich noch dazu.
Machst du schon Pläne für deine Zeit nach dem Kleinen Theater?
• Der Vertrag läuft erst mit Juni 96 aus. Es wird mir immer wieder unterstellt, daß ich aufhöre, weil ich ein viel, viel besseres Angebot hätte. Das stimmt nicht. Es ist so, daß ich jetzt das Theater durch eine neue Struktur schuldenfrei machen und meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin übergeben will mit einer Basis, auf der man arbeiten kann. Das ist mein Ziel, und ich überlege nicht jetzt schon, wo ich am 1. September 96 anfange.
Was ist das für eine Struktur, von der du sprichst?
• Struktur, das klingt so nach positiver Veränderung. Im Endeffekt ist es eine Veränderung ins Negative. Ich habe vom Vorstand den Auftrag und auch von der Bank mehr oder minder aufgedrückt bekommen, ein Programm zu erarbeiten, mit dem die Schulden abgebaut werden können. Die großen Kostenfaktoren sind beim Personal und bei den Produktionskosten. Es wird Reduktionen geben. Aber es wird ganz sicher keinen Qualitätsverlust geben, denn dann wäre es viel vernünftiger, sofort zu schließen.
Wie ist es zum Schuldenstand von 1, 2 Millionen überhaupt gekommen?
• Da haben nicht wir gemurkst! 70% davon sind Gelder, die noch ausständig sind. Von der Stadt! Weil Vereinbarungen, bezüglich Valorisierung etwa, nicht eingehalten wurden. Da gibt es noch Rückstände aus dem Jahr 92! Es geht also um Gelder, die zugesagt waren und nicht kamen, und die ich jetzt als Schuldenstand abarbeiten muß.
Es ist nicht bloß ein Punkt dafür verantwortlich, daß ich sage: »Schluß, aus, danke!« Es sind Mosaiksteinchen, die mich dazu gebracht haben. Es ist kein Davonlaufen! Es ist der Punkt erreicht, an dem ich mir sag: So will ich nicht mehr!
Hast du deine kreativen Anteile und deine Checkeranteile als Theaterleiter eigentlich zufriedenstellend vereinbaren können?
• Das ist auch einer dieser Mosaiksteinchen. 75% ist Checken und 25% ist Kulturarbeit. Da fragt man sich schon auch: Warum mach ich das eigentlich? Ich hab mir nicht das Ziel gesetzt, Checker zu sein, Manager zu sein. Da ginge ich besser wo anders hin und verdiene das Doppelte.
Mir wurde vorgeworfen, daß ich gerade jetzt gehe. In Zeiten wie diesen ist es notwendig, Widerstand zu leisten und nicht einfach aufzugeben, bekam ich zu hören. Was heißt »gerade jetzt«? Ich leiste seit 15 Jahren Widerstand. Die nächste Frage ist: Was heißt »Widerstand«? Ich kann Editorials schreiben, ich kann über die Presse agieren, ich kann Aufrufe machen, ich kann auch Demonstrationen machen, und bestenfalls bewirke ich, daß diskutiert wird. Im schlechtesten Fall kriege ich mit der Rute eine auf die Hand. Ich glaube, daß es uns alle gibt, darin liegt schon sehr viel Widerstand.
Du bist pessimistisch. Ich kann dem im Moment nicht einmal was entgegenhalten. Es ist so nüchtern.
• Ja, es ist nüchtern, es ist nüchtern. Aber ich bin dem ganzen Bereich Kunst und Kultur gegenüber immer noch optimistisch. Ich bin auch bezüglich meiner Nachfolgerin oder meines Nachfolgers optimistisch. Ich bin nur meiner eigenen Situation gegenüber pessimistisch.
Kunst und Kultur ist ja an und für sich schon Widerstand. Nicht gegen die Gesellschaft, sondern gegenüber einem System, das unfähig geworden ist, mit Kunst und Kultur als etwas Positivem umzugehen. Es müßte viel öfter passieren, daß es dieses Angebot plötzlich nicht mehr gibt, so wie wenn der Strom ausfällt, sodaß den Leuten bewußt wird, daß Kunst und Kultur ein Lebensmittel ist.
Wie waren deine Erfahrungen mit Bündnispartnern in diesen Jahren? Hat es verläßliche gegeben?
• Ja! Das Land! Das waren auch die ersten und einzigen von politischer Seite, die sich auf meine Entscheidung hin sofort gerührt und das Gespräch gesucht haben.
Othmar Raus?
• Ja.
Gab es verläßliche Bündnispartner innerhalb des eigenen Feldes in Salzburg? (Lange Pause) Offenbar gar nicht so einfach dieses Thema ...
• Ja, gar nicht so einfach ... Es ist so: (Pause) Ich glaube, wir lieben uns alle, sollten uns aber nicht zu lange den Rücken zukehren. (Lachen)
Ich sehe viel Aversion im Feld, weiß aber nie, worauf sie basiert.
• Das meine ich ja. Das Bild, das wir nach außen vermitteln, ist, daß wir uns sehr gut verstehen und auch zusammenarbeiten können und und und ... Mit »den Rücken zukehren« meine ich, daß man sehr schnell »ausgerichtet« wird, wenn man es tut. Der direkte Zusammenschluß existiert nicht. Warum in Kunst und Kultur dieser ungesunde Egoismus vorherrscht, weiß ich nicht. Der tat uns noch nie gut und wird uns auch nie gut tun. Weil wir dadurch viel zu leicht zu Spielbällen werden. Wenn die Not den einzelnen frißt, sind die Brotspenden sehr klein. Wenn die Not alle frißt, dann sind alle bereit, für alle da zu sein.
Danke für das Gespräch. Auf eine gute Zukunft!
Das Gespräch führte Harald Friedl.