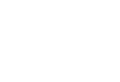Kürze linear, dann kann nichts schiefgehen
Sozialpolitik in Salzburg: Schwarzblaue Visionen und grauer Alltag
Leicht könnte sich für den Sozialbereich in der Stadt Pandoras Kiste auftun, wenn tatsächlich realisiert wird, was durch die Mehrheit von ÖVP, F, Masopusts Liste und Auto-fahrern am letzten Maitag im Gemeinderat festgemacht worden ist. Würde der beschlossene Budgetvoranschlag für 1996 Realität werden, so kämen der Wohlfahrtsabteilung statt den heuer zur Verfügung stehenden 599 Mio Schilling nur mehr 554 Mio zugute. Über die Folgen hatten Medien schon hinlänglich berichtet: Zahlreiche soziale Initiativen würden leer ausgehen und letztlich zusperren können. Für Jugendarbeit stünde genauso kein Geld mehr zur Verfügung wie etwa für die Aids-Hilfe oder den Blindenverband. Die Nachbetreuung psychisch Kranker wäre ebensowenig finanzierbar wie Tageszentren für alte Menschen - und so weiter und sofort.
Mit einer Implosion der Sozialausgaben versucht die volksnahe Front der vier besagten Parteien also, einer vermeintlichen Explosion sozialer Kosten entgegenzuwirken. Nur ist das Horrorszenario einer ausufernden Steigerung der Sozialausgaben gelinde gesagt halbwahr; Finanzreferent Dechant argumentiert mit der fast Viertelmillarde Schilling, die als Rückzahlungen aus dem Sozialtopf an das Land fällig sind. Im Gegenteil dazu gebe es im Sozialhilfebereich, so Sozialstadtrat Josef Huber (SPÖ), sogar eine eher rückläufige Tendenz. Wenn F-Klub-obmann Mainoni unbeirrt dessen die »Kostenexplosion« heraufbeschwört, die konsequente Kontrolle erfordere, so stimmt er hier in den altbekannten Kanon des »Miß-brauchs« ein. Josef Huber: »Mit dieser ganzen Hysterie versucht man, das auf eine Ebene zu führen, daß wir Sozialhilfeschmarotzer unterstützen.«
In Schulterschlußweite zur Sozialmißbrauchs-Diktion ist wohl auch der Amtsbericht von eingangs erwähnter Gemeinderatssitzung zu bringen, der »alle Anstrengungen« in Aussicht stellt, »um das verbleibende Strukturdefizit unverzüglich völlig zu bereinigen, damit die Stadt ihren finanziellen Handlungsspielraum wiedererlangt«; »die Stadt«, das klingt hier nach einer Monopoly-Spielfläche, von der soziale Kosten ohne weiteres wegzurationalisieren sind. Um die Stadt sauberzuhalten von offenbar nicht wählerstimmenträchtigen Sozialthemen, wären einfach die Finanzen für die freiwilligen Leistungen »zu bereinigen«.
Dabei macht die privilegierte Kaste der Gemeinderatsmitglieder soziale Bedürftigkeit zu einer Privatangelegenheit, die durch fleißige Arbeit (entgolten wohl durch diverse Taggelder und Sonderzahlungen) offenbar problemlos aus der Welt zu schaffen wäre. Bezeichnend für diese Haltung sei, »daß die Probleme individualisiert werden. Fast überall wird nach Fehlern gekramt, die von den Betroffenen gemacht wurden«, sagt Silvia Lechner von der Fachstelle für Gefährdetenhilfe. Primäre Aufgabe dieser Einrichtung ist es, Delogierungsgefährdeten zu helfen, ihre Wohnung zu behalten; die Klientel entspricht keineswegs dem gängigen Klischeebild vom Sozialhilfeempfänger, sondern besteht hauptsächlich aus Berufstätigen und Rentnern. Silvia Lechner: »In der Summe aller Fälle, die auftauchen, kann ich wirklich nicht mehr individualisieren. Es zeigt sich ganz deutlich, daß die akute Wohnungsnot ein gesellschaftliches Problem ist, das geleugnet und in den Randgruppenbereich geschoben wird.«
Präventives Arbeiten & Präventivmaßnahmen dagegen
Während das Einkommen in Salzburg unter dem bundesweiten Durchschnitt liegt, verzeichnen Wohnungspreise europäische Spitzenwerte. Die daraus entstehenden Probleme stempeln Betroffene schlichtweg zu »Sozialfällen«. Silvia Lechner: »Die Sozialhilfe muß herhalten für Versäumnisse in Wohnbau und Raumordnung. So hat man derart günstige Konditionen für Renovierungen geschaffen, daß Spekulanten sozusagen am Silbertablett die Möglichkeit geboten wurde, Mieten um ein Vielfaches zu steigern.«
Präventivarbeit bedeutet, diese Probleme nicht einfach auf den Sozialhilfetopf als letzte Instanz abzuschieben, denn »irgendwann ist das Budget wirklich gar, und dann gibt es überhaupt keine Perspektive mehr, sondern nur noch die Meldung: Kein Geld!«, so Silvia Lechner. »Einen Schritt vorher anzusetzen und in der Planung etwas zu machen, ist in den letzten Jahren vernachlässigt bis völlig ausgespart worden. Man hat dagegen einfach eine Novellierung des Sozialhilfegesetzes gemacht: Jetzt gibt es nicht mehr 172.- Schilling pro Quadratmeter, sondern nur mehr 154.-, ungeachtet dessen, ob es realistisch ist, einen Wohnraum um diesen Preis zu finden.«
Die Salzburger Fachstelle für Gefährdetenhilfe ist österreichweit die erste Einrichtung dieser Art. Vorausgegangen ist dem ein Forschungsprojekt im Auftrag von Land und Wohnbaugenossenschaften, das ganz deutlich die unmittelbaren Einsparungsmöglichkeiten unter Beweis gestellt hat; Kernaussage: Es gibt für die Kommune kaum etwas Teureres als die (finanziellen wie sozialen) Folgen einer Delogierung. Die Fachstelle nimmt der Klientel die bürokratischen Hürden ab, die allein schon dadurch entstehen, »daß der Druck auf die Referentinnen und Referenten, beim Sozialhilfevollzug zu sparen, recht groß ist. Selbst für uns wird da jeder einzelne Schritt unglaublich mühsam. Für den Klienten ist die Belastung unwahrscheinlich.«
Während vergleichbare Einrichtungen in Köln oder Hamburg bei der Stadt angesiedelt sind, hat man sich in Salzburg entschlossen, dies über einen privaten Träger aufzuziehen, »weil es hier nicht danach aussieht, daß die Kommunikation zwischen den Ressorts Sozialhilfe, Wohnungsverwaltung, Vermieter und Finanzen so funktionieren könnte, daß Lösungen über einen kurzen Weg zustandegebracht werden«, sagt Silvia Lechner. Und: »Ich blicke da immer ein bißchen neidvoll nach Deutschland.« Die Fachstelle ist ein autonom arbeitender Teilbereich der »Soziale Arbeit GmbH«, einer Anfang 1994 gegründeten gemeinnützigen Gesellschaft, die neben Sozial- und Delogierungsberatung auch betreute Wohnungen sowie auf ein Jahr befristete Arbeitsplätze für sozial Gefährdete bietet. »Wir versuchen, an der sozialen Notlage zu sein, noch ehe sie akut eintritt, denn so kann man noch umso besser handeln. Und vom volkswirtschaftlichen Standpunkt wird es desto billiger, je früher man das Ganze auffängt«, so Christian Holzer, Geschäftsführerstellvertreter der GmbH.
Einem privaten Träger jedoch fällt bezüglich Finanzen die altbekannte Rolle des Bittstellers zu. Christian Holzer: »Da haben private Leute von Vereinen einen Bedarf geortet, Projekte umgesetzt und geschaut, daß sie finanziert werden. Wenn man dann zu den Subventionsgebern geht, heißt es für gewöhnlich: Dafür ist kein Geld vorhanden. Im Sinne einer Sozialplanung müßte das eigentlich umgekehrt ablaufen. Wenn die Stadt ein Bauvorhaben hat, dann schreibt sie es auch aus.« Zumindest von seiten des Landes ist die GmbH für drei Jahre abgesichert; was die Finanzierung durch die Stadt angeht, steht - wie für so viele soziale Einrichtungen - für nächstes Jahr noch alles offen.
Es wäre gewiß sinnvoller und kostengünstiger, die im Präventionsbereich arbeitenden Einrichtungen zu unterstützen, als, wie Christa Schlager von Demokratie 92 sagt, »steigende Sozialkosten zu bejammern, auf die die Leute ohnehin gesetzlichen Anspruch haben.« Dadurch, daß ein längerfristiger Sozialplan fehlt, mit dem auch ge-meinnützigen Vereinen oder Gesellschaften verbindliche Rechte eingeräumt würden, delegiert die öffentliche Hand auf elegante Weise die Verantwortung; Christian Holzer: »Man verlangt von diesen Einrichtungen, sie sollen nach marktwirtschaftlichen Richtlinien arbeiten. Diese Institutionen sollten leisten, was die öffentliche Hand mit ihrer Bürokratie nicht schaffen kann, ohne daß man ihnen lang- oder mittelfristige Absicherung bietet. Das heißt konkret: Man betreibt eine Firma oder einen Verein mit Dienstleistungsangebot und weiß von einem Jahr aufs andere nicht, ob man diese Dienstleistungen noch anbieten kann. Und wo bekommt man in der privaten Wirtschaft Fachkräfte, wenn man sagt: Ich kann dich heuer einstellen, weiß aber nicht, ob ich dich nächstes Jahr wieder finanzieren kann.«
Weitblickende Sozialarbeit, die Versäumnisse von Stadt, Land und Bund ausbügelt, wird somit zur Angelegenheit von Privatiers gestempelt; stellen diese gerechtfertigte Ansprüche an die öffentliche Hand, ist es ein leichtes, sie ins Eck der »Schmarotzer« zu stellen.
Auf zur sozialen Marktwirtschaft?
Gerade von ÖVP und F komme ständig die Forderung, die Einrichtungen mögen selbst ihre Finanzen aufbringen, so Christa Schlager, doch »wenn ich schwierige Jugendliche betreue und nebenbei Ostereier anmalen muß, wünsche ich mir viel Spaß.«
Christian Hochhold, Leiter des Salzburger Kinderschutzzentrums, hat es erreicht, daß ein Viertel des Budgets aus der Wirtschaft einfließt; die anfallenden Miet- und Betriebskosten werden seit Jahren zur Gänze von einer Privatbank gedeckt, den Kindertherapiebereich finanziert ein Kopiersystemkonzern. Er sieht es auch als Pflicht jedes leitenden Funktionärs, sich über Zusatzfinanzierung aus dem Privatbereich Gedanken zu machen: »Für den laufenden Betrieb sollten Sozialeinrichtungen aber ganz klar Anspruch haben auf öffentliche Gelder.«
Der »Sozialmanager« (Eigendefinition) räumt dabei ein, daß gerade Kinderschutz auch als »griffiges Thema in der Öffentlichkeit gut darzustellen« sei. Bei der Suche nach potentiellen Geldgebern stellt sich daneben auch für ihn das Problem, daß im Gegensatz zu Spenden für wissenschaftliche Zwecke oder Kultur private Gelder im Sozialbereich nur abschreibbar sind, sofern sie als Werbungsausgabe geltend gemacht werden; dies jedoch liege, so Hochhold, letztlich »im Ermessen des zuständigen Bearbeiters der Finanzbehörde, ob er so eine Aktion grundsätzlich anerkennt oder nicht.«
Die Gesetzeslage macht es den Sozialeinrichtungen nicht einfach, den von den öffentlichen Würdenträgern gewünschten Schwenk ins Privatwirtschaftliche auch nur ansatzweise durchzuziehen.
»Freiwillige Leistungen werden im Sozialbereich von ein paar kleinen Vereinen erbracht; die leisten wichtige Arbeit und machen einen minimalen Pro-zentanteil im Budget aus. Selbst wenn man sich die alle mit einem Schlag spart, hat man das Budget in keiner Weise gerettet, sondern nur die Struktur zerstört.«
Christa Schlager (Demokratie 92)
ÜBERLEBENSFRAGE
Daß eigene (!) Arbeit mit Reichtum nicht zwingend in Verbindung steht, ist spätestens seit Karl Marx hinlänglich bekannt; daß Arbeit nicht vor Armut schützt, ist zwar auch nicht ganz neu, aber angesichts der restriktiven Sozialpolitik von Bund, Land und Stadt sollte man sich dessen - gerade als Berufstätiger - bewußt sein. Denn wen es trifft, ist beliebig; oft reicht schon eine Mieterhöhung, eine Krankheit oder »das Pech«, ein Kind zu bekommen.
tom