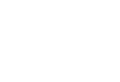Monopoly mit vorhersehbarem Ausgang
Noch hat es so wirklich niemand gesehen, das große Geld der Sponsoren
Bisweilen wird die Finanzspritze Privatwirtschaft von der Journaille wie auch von der Politik in einem ehrfurchtvollen bis hochtrabenden Ton heraufbeschworen. Schlichtere Gemüter - insbesondere wenn ihnen ihre partei- politische Laufbahn ermöglichte, sich öffentlich in kulturpolitischen Belangen Luft zu machen - läuten schon verbal die große Umverteilung ein: Die Rede ist dann von den Staatskünstlern, die, wenn schon nicht außer Landes, dann zumindest auf den freien Markt getrieben gehören. Die freundlicher klingende Variation zum selben Thema wäre die feierlich proklamierte harmonische Liaison von Wirtschaft und Kultur. Nicht ungern werden in diesem Zusammenhang die USA als Vergleich herangezogen, denn schließlich solle dort, so der gängige Mythos, Kultur ebenfalls haupsächlich durch das Sponsoring privater Unternehmen finanziert sein. Dem ist allerdings nicht ganz so: Nebst den tatsächlich bescheidenen Mitteln öffentlicher Förderung sind es primär die Verkaufserlöse, mit denen sich kulturelle Institutionen über Wasser halten; möglich wird dies vor allem durch die steuerlichen Begünstigungen beziehungsweise Befreiungen für diese Art von Einrichtungen.
Auch auf dem nordamerikanischen Kontinent fällt dem eigentlichen Sponsoring - also einer kulturellen Leistung, die für Geldgeber aus der Wirtschaft mit einem positiven Image-Transfer im Sinne von Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit verbunden ist - eher eine marginale Rolle zu. Viel bedeutender sind sowohl in den USA als auch in Kanada Mittel privater Förderinnen und Förderer, also jener Bereich mit dem wohlklingenden Namen »Philanthropie«. Zwar wird gerade seitens der F, doch auch in Kreisen der ÖVP und der Liberalen gedrängt, die Kultur vom staatlichen Geldhahn in die vermeintliche Freiheit des Mäzenatenmarktes zu entlassen, allerdings bietet die Neue Welt bei Kulturförderung steuerliche Vorteile, die in unseren Breiten nicht gegeben sind. Und letztendlich würde es sich hier doch nur um eine Um- schichtung von Steuergeldern handeln; der Einschätzung von Lutz Hochstraate, dem Intendanten des Salzburger Landestheaters, daß in Österreich daher die Kultur den Staat letztendlich nicht mehr kostet als in den USA, ist durchaus beizupflichten.
»Faust für Manager«
Eine repräsentative Kultureinrichtung wie die Landesbühne der Mozartstadt ist fraglos ein imageträchtiges Objekt für Sponsoren. Selbst Porsche nutzt die positiven Synergieeffekte (wie der Intendant betont: gewinnbringend) zur Hebung der Unternehmenskultur, etwa mit Workshops für die oberen Etagen unter erfolgsverheißenden Titeln wie »Faust für Manager« oder »Sokrates & Co.«. Lutz Hochstraate vergleicht allerdings den Arbeitsaufwand, um von der kulturinteressierten Wirtschaft die im Vergleich zum Gesamtbudget doch eher bescheidenen Mittel auszuheben, mit jenem, der zur Inszenierung von Faust I und Faust II notwendig ist. Selbst für die international renommierten Festspiele, eine Kulturinstitution, bei der Geschäftssinn ganz offensichtlich ein entscheidendes Moment des eigenen Selbstverständnisses ausmacht, sind 20 Millionen Schilling Sponsorengelder bei dem Jahresbudget 1997 in der Höhe von 565 Millionen (171,3 Millionen davon Subventionen) kein Betrag, der die Förderung der öffentlichen Hand in irgendeiner Weise ersetzen könnte.
Was den Prozentsatz an Geldern aus der Wirtschaft betrifft, kann zwar etwa das Salzburger Rockhouse den Festspielen spielend das Wasser reichen, dennoch wird im Bereich der freien Kultur die Situation eine zunehmend schwierigere. Jene Institutionen, die nicht einmal über mittelfristige Förderungen verfügen und derzeit durch empfindliche Budgetkürzungen und die Werkvertragsregelung sogar Schwierigkeiten haben, die allernotwendigste Infrastruktur aufrechtzuerhalten, sind schon rein personell schlichtweg außerstande, der aufwendigen Tätigkeit des Keilerns von Sponsorengeldern nachzukommen. Außerdem sind Mittel aus der Privatwirtschaft grundsätzlich an attraktive Angebote mit Ereignischarakter gebunden, und nur in Ausnahmen an Strukturförderung. So läßt auch das Wirtschaftswunder Stadtkinosaal auf sich warten. Nachdem sich die Salzburger »Szene« nur mehr auf das Sommerfestival konzentriert, fungiert dieser Saal über das Jahr gleichsam als Leergebinde für potentielle Kulturverantstalter. Lediglich die allernotwendigsten infrastrukturellen Kosten sind abgedeckt, und es steht keinerlei Veranstaltungsbudget zur Verfügung. So bleiben - bis auf den traditionellen »Szene«-Förderer Trumer-Bier - auch die Sponsoren aus, denn diese verlangen als Gegenleistung ein herzeigbares programmatisches Profil.
»Weiß, männlich und tot«
In Großbritannien, wo Kultursponsoring sich innerhalb von mehr als drei Jahrzehnten hoch entwickelt hat, warnte vor einigen Jahren die »Association for Business Sponsorship of the Arts« vor jener Austrocknung der staatlichen Mittel, die mit der Ära Thatcher Einzug hielt, denn diese führe dazu, daß kulturelle Einrichtungen entschieden an Attraktivität für Geldgeber aus der Wirtschaft einbüßen. Wenn in Österreich die Mittel des Bundes nunmehr so umgeschichtet werden, daß sie eher punktuelle Spektakel mit Eventcharakter als die Aufrechterhaltung von Infrastrukturen begünstigen, wird dies im Bereich der Kultur mit Sicherheit eine empfindliche Umverteilung zur Folge haben. Sofern es übertrieben klingen mag, hier Tendenzen zu einer monetär bedingten Zensur festzustellen, so trifft zumindest Marktdarwinismus zu: Zunehmend öffnet sich nämlich die ökonomische Kluft zwischen einer vitalen Kultur mit Bezug zu Ort und Zeit einerseits und den imageträchtigen Sicherheiten künstlerischer Autorität und Musealität andererseits. Mit 113 Millionen Schilling fördert die deutsche Telecom das Megaspektakel »Epoche der Moderne«, deren Repräsentanten - von Picasso bis Beuys - vornehmlich die Hauptcharakteristika weiß, männlich und tot aufweisen. Die Ausstellung wird vorerst in Berlin, dann noch in New York und London gezeigt - in Ländern also, wo die deutsche Telecom um größere Marktanteile buhlt. Auch in kulturellen Belangen ist die Ökonomie wohl nicht unbedingt eine verläßliche Partnerin zur Standortsicherung.
In der Welt des Sponsoring wird vor allem eine Figur kaum in Erscheinung treten, nämlich jene des selbstlosen, freigiebigen und philanthropischen Mäzens. Nur selten werden sich Sponsoren über massenkompatible Halbavantgarden hinauswagen und Innovatives zulassen, wie etwa in Salzburg Josef Siegl von der Brauerei Trumer. Im Big Business ist Kultursponsoring immer seltener Chefsache und weist von demher auch immer weniger die Züge persönlicher Liebhaberei auf; jene Managerkonsortien, welche die großen Konzerne leiten, sind schließlich auch im Bereich von Kulturausgaben den AktionärInnen Rechenschaft schuldig. Eine auch steuerlich überaus attraktive Ausnahme im Kultursponsoring sind Stiftungen; auf diesem Wege wurde etwa der Barpianist Karl Wlaschek ein wohlhabender Mann. Im generellen ist das fiskale System der Alpenrepublik jedoch sicherlich ein eher restriktives bis undurchsichtiges. Bisweilen hängt es tatsächlich vom guten Willen der Beamten ab, ob Gelder für die Kultur im Etat für Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit zu verbuchen und daher abschreibbar sind. Böse Zungen behaupten gar, daß Ausgaben im Kulturbereich mitunter Finanzprüfungen nach sich ziehen können: Wer sogar für sowas Geld ausgibt, gehört schlußendlich etwas genauer unter die Lupe genommen. Doch auch ein des öfteren gefordertes liberalisiertes Steuersystem in Sachen Kultur wäre nicht unbedingt nur von Vorteil. So sprach die SPÖ sich stets gegen die Steuerbefreiung für Kunstankäufe aus, denn schließlich würde diese primär Großsammlern wie Banken zugute kommen, die in ihrer Kapitalanhäufung mit dem attraktiven Anstrich des Mäzenatentums auch noch indirekt staatlich gestützt würden.
Den großen versöhnlichen Gesten zwischen Wirtschaft und Kultur ist mit einer gewissen Skepsis zu begegnen, im speziellen auch dann, wenn Kulturarbeit zunehmend über die Gebärden des hohen Managements definiert wird, wie dies auch im Bereich der freien Kultur gang und gebe ist. Außer einer inhaltlichen Aushöhlung und einem gesellschaftsfähigen Vexierbild des Professionalismus bringt das bemühte Nacheifern hinter Marktgesetzen unterm Strich zumeist gar nicht so viel ein; viel eher kommt hier das traurige Bild eines Monopolyspiels mit vorhersehbarem Ausgang auf. Wie seltsam die Geldvergabekriterien der öffentlichen Hand auch erscheinen mögen, so gewährleisten sie mit Sicherheit mehr Freiraum in der Kultur denn eine vermeintliche Objektivierung durch den freien Markt.