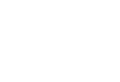Tal- und Bergfahrt
Zur Salzburger Museumsdiskussion
Daß in Mürzzuschlag und Krems, in Bregenz oder gar in St. Pölten neue Museen entstehen, nicht aber in Wien, Graz, Salzburg..., wo Behörden, Architekten, Parteien, kleinformatige Zeitungen und Bürgerinitiativen endlos mit- bzw. gegeneinander quälend diskutieren, bis irgendwelche Um- und Einbauten als Planreste realisiert werden, ist einerseits typisch, andererseits nicht notwendigerweise eine Katastrophe. Hauptstädte leben ihrer Bedeutsamkeit gemäss in der Vergangenheit, sie zehren von ihrem irgendwann einmal erworbenen Ruf - in ihrer Sattheit fehlt den Erben der Hang zur Aufbruchstimmung. Zudem gibt es keine »richtige« Theorie des Museums, sondern nur den Drang zu Entscheidungen, die den wechselnden machtpolitischen (und weniger kulturpolitischen) Interessen und Möglichkeiten folgen und das jeweilige historische Reflexionsniveau spiegeln.
Die aus den Kunst- und Wunderkammern im 19. Jahrhundert hervorgegangene neue Bauaufgabe des Museums war eine Idee des Historismus. Die meist höfischen Sammlungen sollten sortiert, wissenschaftlich bearbeitet, betreut und vor allem geordnet werden, weil sich darin jenes historische Be-wusstsein ausdrückte, das in den letzten Jahrzehnten seine Selbstverständlichkeit in fast beängstigender Weise wieder zu verlieren droht. Nicht zuletzt deswegen stehen einander in der derzeitigen Situation Salzburgs unversöhnliche Standpunkte gegenüber. Wenn in Österreich derzeit Kultur »Chefsache« ist und sich auch ein Landeshauptmann nicht mehr mit Ordensverleihungen und Eröffnungsreden zufrieden gibt, darf man darauf hoffen, dass sich nach der wievielten (?) Machbarkeitsstudie endlich die hohe Politik zu einer Entscheidung herablässt und sie gegen die Verstocktheit von uneinsichtigen grünen oder freiheitlichen Denkmals-Fundamentalisten durchsteht.
Holleins Museum im Berg ist nicht an den Kosten gescheitert, sondern an der fehlenden Sammlung und am Stolz der seit jeher fremd bestimmten Bürger, die es irgendwann satt hatten, sich von importierten Erzbischöfen, Festspielstars, Universitätsmenschen undsofort Vorschriften machen zu lassen und sich in diesem Fall nicht zur Filiale eines New Yorker Museumsmanagers degradieren lassen wollten, der anlässlich seiner Festspielbesuche irgendwelche, und seien es noch so hochkarätige, Wanderausstellungen glanzvoll (unter den Scheinwerfern der »Seitenblicke«) eröffnet hätte. Das wäre keinen Tourismus-Gau wert gewesen.
Auch der oberösterreichische, in Wien erfolgreiche Kunsthistoriker und Ausstellungsmacher Klaus Schröder stösst nicht zuletzt deswegen auf Ressentiments der Salzburger Granden, weil er das Pech hat, kein Einheimischer zu sein. Nur aus der Tatsache, dass sich der Altlandeshauptmann Katschthaler nicht für ihn als SMCA-Direktor entschieden hat, ist ihm kein Vorwurf zu machen. Immerhin hat er danach das sensationelle Angebot abgelehnt, Direktor des Van Gogh Museums in Amsterdam zu werden.
Sein Konzept erscheint sinnvoll, weil es in konservativer (historischer) Weise mit dem kleinteiligen Durcheinander aufräumt und klar-konturierte Einheiten schafft. Allerdings relativiert er die Werkbestände, und darin liegt das eigentliche, gerne verdrängte Problem Salzburgs. Im SMCA hat niemand je die reichlich komplizierte Geschichte des Fürsterzbistums begreifen können; im engen Rupertinum hat noch fast jedes Gemälde seine Ausstrahlung einge-büsst; das Barockmuseum ist nie über einen privaten Charakter hinausgelangt; nicht zuletzt besitzt trotz der Residenzgalerie Salzburg keine Sammlung von internationalem Profil, die zwischen München und Wien irgendwen zu einem Zwischenstop »bewegen« könnte. Die neuerdings als Weltkulturerbe geadelte Stadt selbst ist das vielgepriesene Museum, das im Rundgang seine Geschichte (etwas zu stolz und theatralisch-oberflächlich) präsentiert. Darin liegt der eigentliche Pfiff von Schröders Konzept, dass er den einmalig-schönen Blick vom Mönchsberg den Kunstinteressierten und nicht den Casino- oder Restaurantbesuchern eröffnet. Das Hubert Sattler-Panorama wäre die ideale Schnittstelle von Kunstgalerie und Stadtshow im runden Breitwandformat. Auf das etwas grossspurig ins Treffen geführte Argument eines zweiten Wahrzeichens gegenüber der Festung kann man getrost verzichten, um der hysterischen Überreaktion die Spitze zu nehmen.
Die Argumente der seit Jahrzehnten schwelenden Salzburger Museumsdiskussion stehen in merkwürdigem Kontrast zu den Problemen in anderen Ländern. In Deutschland geht es trotz der geradezu beängstigenden Museumsdichte (wie in Nordrhein-Westfahlen) und neu entstehender, auch privater oder Firmen-Museen (wie in Künzelsau oder Wolfsburg) eher darum, den zahlreichen bedeutenden privaten Sammlern, von denen der masslose Peter Ludwig nur die sprichwörtliche Spitze des Schokoladeneisbergs darstellte, eine Heimstatt oder wenigstens zusätzliche Präsentationsmöglichkeiten zu bieten. Da werden Sammlungen von Mönchengladbach nach Berlin, von Darmstadt in den Kunsthandel, von verschiedenen Seiten nach Bremen und Hamburg oder vagabundierend auf Tourneen verschickt, um als hoch versicherte Manövriermasse gesellschaftlicher Prestigewerbung zu dienen. Jede Stadt wäre glücklich, wenn sie heute ausreichende Mittel hätte, wie sie noch in den siebziger Jahren etwa in Frankfurt zu einem beispiellosen Museumsboom genützt wurden, um die Schätze hüten zu dürfen. Im Gegensatz zu anderen Ländern, auch der Schweiz oder Italien, von den USA ganz zu schweigen, wird in Österreich einer nicht gestifteten, sondern angekauften (oder abgestotterten) Sammlung ein Museum gebaut. In Österreich gibt es nur eine steuersparende, aber keine für eine Stiftungskultur günstige Rechtslage. Die grössten Privatvermögen dienen jedenfalls keinen sichtbaren kulturell-mäzenatischen Ambitionen. Sollten allerdings Sammler zu gewinnen sein wie der in Wien schnöde abgewiesene BauMax-Essl, der in seinem Klosterneuburger Firmensitz nur einen Bruchteil seiner Schätze österreichischer Nachkriegs- und Gegenwartskunst präsentieren kann, wäre es arrogant, blind und dumm, sich dafür nicht zu interessieren.
Im staatlichen Bereich sind die ideologischen Grenzen längst verwischt, weil sogenannte Sachzwänge oder Profilierungswünsche zu Entscheidungen drängen. Es waren nicht die Linken in Frankreich, sondern die Präsidenten Pompidou und Mitterand, deren Bauten eine kulturelle Neuorientierung erzwangen. Oder man denke an München, wo massgeblich von privater Seite oder von Firmen und Banken ein Neubeginn ermöglicht wird. Es ist nicht die CSU, sondern ein anderer Ministerpräsident, dem irgendwann bewusst wird, womit er sich langfristig Lorbeeren sichert, und wenn es denn mit einer Pinakothek der Moderne sein muss.
Demnach sollte gar nicht zur Debatte stehen, ob die Argumente der abgehalfterten Haudegen - der derzeit entmachteten beziehungsweise nicht mehr gehörten Notablen wie Karl-Heinz Ritschel und anderer Museumsfunktionäre oder des einer Fehlinformation aufsitzenden, unermüdlichen Sedlmayr- Adepten Herbert Fux, der in der Kronen-Zeitung in klassischer Politiker-Manier für »Tausende« Mitbürger zu sprechen sich herausnimmt - mit dem Verweis auf gewachsene Strukturen einerseits oder eine nach Entwicklungsgesichtspunkten (Epochen) ausgerichtete Neuordnung à la Schröder andererseits überzeugender sind. Es sind die alten, unentscheidbaren Glaubenskämpfe: Die einen haben sich emotional an die Fiktion eines quasi-naturhaften statischen Gesamtkunstwerks (»Stadt als Bild«) gewöhnt, die anderen argumentieren mit der lebensnotwendigen Gegenwart, aus der heraus Geschichte immer neu zu interpretieren ist. Vielmehr muss man sich im klaren sein, dass eine Umsiedlung die Sammlungen nicht interessanter macht, d.h. keine neuen Besucherschichten anlocken wird.
Allerdings können Umstrukturierungen dieser Art auf lange Sicht eine Bewusstseinsveränderung bewirken, die man mit »Lebensqualität« umschreibt. Niemand kann sich vermutlich vorstellen, was jemanden in den Ruhrpott locken sollte, wenn man nicht die Fülle des musealen und kulturellen Angebots sowie die Metamorphose einer zugrunde gehenden Bergbaugegend in eine weltweit einmalige industriearchäologische Landschaft kennengelernt hat. Hier gewinnt eine verunsicherte, durch hohe Arbeitslosigkeit entwurzelte Bevölkerung eine neue Identität, und dies heisst eine spezifische Besinnung auf die eigene Tradition. Der Verlust wird kompensiert durch eine Kultur der Erinnerung, und soll sie noch so populär inszeniert werden, wie die in Essen derzeit von Andre Heller konzipierte Zechen-Erlebniswelt.
Salzburg leidet darunter, dass sich seine Bevölkerung diese Art einer Vergangenheitsbewältigung ersparen zu können glaubt, weil der zur Identität führende Zwang der Besinnung durch die Ästhetik des Ortes ersetzt ist. Dieser trotzige Verzicht auf kontextuelles Denken ist nicht ungefährlich: Wer die alte Bausubstanz und die Grünzonen der Stadt als Denkmäler verteidigt, verlagert den notwendigen Wohnbau ins vordem grüne, aber nach und nach zersiedelte Umland. Die Stadt wird zum Vakuum, das regelmässig unter dem Verkehrsaufkommen seiner ins Zentrum drängenden ehemaligen Bürger kollabiert. Der Gewinn eines auf ewig erhaltenen Stadtbildes, in welchem nur alte Bauten neu errichtet werden (Mozarts Wohnhaus), wird mit der Entvölkerung und sozialen Verödung bezahlt. Wer heute ausserhalb der Hochsaison aus dem »Exil« nach Salzburg kommt und abends durch die Altstadt schlendert, erschrickt vor dem gelackten Ghetto einer unbelebten Stadt und träumt von der schlechten alten Zeit, als der Putz von den grauen Mauern bröckelte und nicht alles in den von der Altstadtkommission und dem Denkmalamt abgesegneten wirklich geschmackvollen Farben erstrahlte.
Zu guter letzt: Der Überrumpelungseffekt hat auch seine guten Seiten, insofern keine neuen Argumente erwartet werden dürften. Diskussionen haben nur bei Lernbereitschaft einen Sinn, und das hiesse, man müsste seine Meinung ändern können. Die derzeitige Chance liegt nicht in den Argumenten, sondern in der vorläufigen Entscheidungsbereitschaft der Politiker, die man lieber nicht an ihrer bisherigen kulturpolitischen Kompetenz messen sollte. Dass schon Pläne von Holzbauer & Co. auf dem Tisch liegen, bringt zwar niemanden in Zugzwang. Aber auch hier wäre unorthodoxerweise zu überlegen, wie sinnvoll eine mühsame Ausschreibung oder ein Gutachterverfahren wäre. Vorbild darin wäre ein anderer Konservativer: Der deutsche Kanzler Kohl, dem man in Kunstbelangen keine glückliche Hand zubilligen darf, wie die scharfe Ablehnung »seines« historischen Museums in Berlin durch Fachleute gezeigt hat, beauftragte immerhin freihändig einen Pei für Berlin. Und ganz zum Schluss: Es nützt die Verwirklichung des schönsten Museumskonzepts nichts, wenn man keinen internationalen, zumindest überregionalen »Intendanten« (und keinen beamteten Kompromiss oder vermeintlichen Star im Ausgedinge) berufen mag oder kann.
Thomas Zaunschirm, Jg. 1943, Kunsthistoriker, Promotion und Habilitation in Salzburg; Gastprofessuren in Zürich und Graz; 1989-1995 Professor an der Universität Freiburg i. Br., seither an der Universität GH Essen. Zahlreiche Bücher zur Kunst des 20. Jahrhunderts und Methodologie; Mitglied des 2. Gestaltungsbeirates; die daraus erwachsene Kritik »Die demolierte Gegenwart - Mozarts Wohnhaus und die Salzburger Denkmalpflege« (Klagenfurt 1987) blieb in Salzburg ohne Wirkung