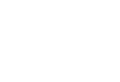»Genug Wasser in die Kanne füllen!«
kunstfehler - exklusiv: Der oberste Kulturbeamte des Landes Salzburg, Herbert Werner, über die Arbeit des Amtes, Förderungen und seine Hoffnung auf eine neue Kulturbewegung
Sie waren lange Zeit im Kulturamt des Landes für die Filmagenden zuständig und sind seit November 1997 Leiter des Kulturamtes der Salzburger Landesregierung. Warum haben Sie sich für das höchste Kulturamt im Land beworben?
• Ich hätte mich nicht beworben, wenn ich jemanden gesehen hätte, von dem ich annehmen konnte, daß er es besser macht als ich. Ich gestehe, daß ich eigentlich befürchtet habe, daß irgend jemand kommt, der für die Leitung der Abteilung nach innen, aber auch für den Kontakt, den Umgang mit unseren Kunden und für allfällige Weichenstellungen deutlich weniger geeignet ist als ich.
Was ist denn an Weichenstellungen möglich? Welchen Spielraum hat denn eigentlich der Beamte? Es gibt ja diesen Spruch: Politiker kommen und gehen, wir Beamte bleiben.
• Der hat viel für sich. Man hat einerseits einen kleinen, andererseits einen großen Spielraum. Theoretisch einen sehr kleinen, weil man immer gezwungen ist, das zu tun, was angeordnet wird. Zum anderen aber hat der Beamte einen großen Spielraum, weil natürlich überwiegend das angeordnet wird, was man sich anordnen läßt. Es werden normalerweise vom Beamten beim Politiker die Weisungen bestellt, da der Beamte die Detailkenntnisse hat. Der Politiker soll nur die großen Linien vorgeben.
Stichwort Detailkenntnis: Wir haben in den letzten Jahren Entwicklungen miterlebt, anhand derer sich die Frage aufdrängt, wozu wir eigentlich eine Kulturverwaltung haben. Beispiel Kleines Theater: Willi Rehberg erzählt, daß die Bilanz des Kleinen Theaters bei den Ämtern immer vollständig und richtig vorgelegen sei. Von der Stadt ist sogar eine positive Subventionskontrolle gekommen, das Land hat sich im wesentlichen zurückgehalten. Wieso habe ich eine Kulturverwaltung, wenn ich für solche Fälle den Herrn Rehberg brauche?
• Diese Kritik hat einen Schwachpunkt: Um die 500 oder mehr Subventionsempfänger zu überprüfen, brauchen wir im Bereich der Überprüfung nicht eine Mitarbeiterin, die noch dazu für diesen Bereich nur zur Hälfte zur Verfügung steht, sondern wahrscheinlich 20. Wir haben unzählige Betriebe dieser Größenordnung oder auch kleiner, zum Teil sind sie unheimlich weit entfernt, im hinteren Pinzgau oder im Lungau.
Es gibt in der Diskussion um das Kleine Theater aus der Stadt politische Signale, die das Wiener Modell von Stadtrat Marboe vorschlagen: Alle Schulden aller Kultureinrichtungen werden einmal von der öffentlichen Hand abgedeckt, wer dann aber in weiterer Folge mit den gegebenen Subventionen nicht auskommt, der geht eben in Konkurs. Wäre so ein Modell für Salzburg denkbar?
• Das ist das einzige richtige Modell, allerdings unter einer Voraussetzung: Die Subventionen müssen in jener Höhe gegeben werden, wie sie benötigt werden. Es nützt nichts, ein Kleines Theater mit einem Betrag zu füttern, der auf jeden Fall zu gering ist, um ein Programm zu betreiben. Wenn ich die Leute heute verhungern lasse, dann muß ich doch bitte sagen, ich bring Euch gleich um. Oder ich lasse Euch leben. Nur diese zwei Möglichkeiten habe ich. Das kardinale Problem liegt nicht in der Mißwirtschaft, sondern darin, daß die trotz ehrlicher Kalkulation die Gelder nicht gekriegt haben.
Im Kleinen Theater haben wir jetzt mit Bill Hayward einen unglaublichen Glücksfall, da sehen wir eine Garantie, daß das weitergeht. Wenn allerdings das Metropolis stirbt, dann hinterläßt das eine riesige Lücke im städtischen Kulturleben.
Die Kooperationspartner und die Anzahl der Ansuchen haben sich potenziert. Wenn dann in der Verwaltung durch die Vielzahl der Anforderungen mit gleichbleibendem Personal und schwindenden Kulturgeldern die Aufgaben nicht mehr erfüllt werden können, kommt der Ruf nach Kontrolle. Unter dem Schlagwort des »New Public Management« heißt es dann: Ausgliedern an kommerziell und marktorientiert handelnde Organisationen. Rehberg kann da als Vorläufer gesehen werden.
• Zuerst: Es gibt keine schwindenden Kulturgelder, die Kulturförderungsmittel steigen nominell laufend. Es gibt nur einen immer größeren Fehlbedarf, die Mittel gibt es nicht in einem Ausmaß, wie es den Anforderungen entspricht. Erfreulicherweise gibt es eben eine immer größere Anzahl von kulturinteressierten Menschen, ein immer größeres Angebot von Betätigungsfeldern und daher auch ein höheres Maß an finanziellen Mitteln.
Wir sind aus unserer Not der personellen Enge in Fällen, wo die Förderbeträge größer sind, dazu übergegangen, die Kontrolle nach außen zu verlagern. Heute gehen wir davon aus, daß, wenn ein Wirtschaftstreuhänder oder Steuerberater mit seiner Unterschrift ordentliches Wirtschaften bestätigt, wir das zur Kenntnis nehmen. Allerdings mit der Einschränkung, daß wir von den Rechnungsprüfern des Vereins verlangen, daß sie auch die Zweckmäßigkeit der Ausgaben bestätigen.
Wir im Amt haben die Vorgabe »minus zehn Prozent im Personalbereich«. Wir müssen überlegen, was ist unsere wichtigste Aufgabe. Ich sehe das im Förderbereich. Unsere Kund-Innen wollen 50.000 Schilling für ein Projekt. Wenn der oder die nach einer halben Stunde wieder hinausgeht, dann weiß er/sie, was er/sie bekommt. Ich finde, das ist die Stärke unserer Kulturverwaltung im Amte der Salzburger Landesregierung, das funktioniert weder beim Bund noch bei der Stadt so...
... in anderen Bundesländern gibt es Fälle, da sind die roten und die schwarzen Vereine, und dann wird den Beamten mitgeteilt, wer wieviel bekommt. Das gibt es in Salzburg dezidiert nicht?
• Das bewegt sich im Prozentbereich: Wenn zu uns einer kommt und sagt, dort bitte soviel, dann werden wir ihn fragen, wem nehmen’s wir bitte weg? Wir haben unsere fixen Kunden Jahr für Jahr, was an Neuem dazukommt ist ja bedauerlicherweise fast zum Scheitern verurteilt. Wir haben nur geringe Möglichkeiten, wirklich zu disponieren.
Wenn man Kultur als Querschnittsfaktor zwischen benachbarten Feldern von Jugend bis Ortsentwicklung begreift, so müßte eine moderne Verwaltung auch als Moderator zwischen den verschiedenen Verwaltungskörpern agieren.
• Mir ist sehr daran gelegen, daß niemand, der mit einem fremden Gebiet zu uns kommt, einfach weitergeschickt wird. Sondern daß man sich in so einer Situation doch bemüht, Kontakt mit anderen in Betracht Kommenden aufzunehmen. Häufig zeigt sich, daß wir ja auch Agenden mitübernehmen. Es gibt zahllose Beispiele, wo wir etwa mit dem Frauenbüro kooperieren, und gemeinsam können wir ein Projekt finanzieren.
Bei den Förderungen erscheint Ihnen das Salzburger Modell - Kunde geht zum Sachbearbeiter, nach einer halben Stunde weiß er in welche Richtung der Daumen zeigt - als praktikabel. Wäre es nicht denkbar, daß man mit Beiratsmodellen und Kuratorenmodellen gerade auf neue Entwicklungen wesentlich flexibler eingehen kann?
• Die Theorie spricht auf jeden Fall dafür, die Praxis dagegen. Erstens handelt es sich bei uns vielfach um »Pemperlbeträge« und wir müßten wegen 25.000 Schilling einen drei- oder fünfköpfigen Beirat zusammenrufen. Die schlimmste Erfahrung der Kunden, die erzählen, wie es ihnen bei anderen Körperschaften ergangen ist, ist, daß sie nicht begründet bekamen, warum sie abgelehnt wurden. In Salzburg muß der Beamte sich dem Kunden gegenüber verantworten. Das Problem bei den Beiräten ist, daß sich alles hinter der Anonymität versteckt.
Gibt es eigentlich Zielkontrollen, was man mit der Kulturarbeit erreicht hat?
• Die Frage nach der Wertigkeit ist höchst problematisch. Da bin ich sofort in der Zensur. Das einzige, was wir uns leisten können, ist die Beurteilung der Qualitätsfrage, aber auch die ist natürlich nicht ganz unproblematisch. Selbst bei der Qualitätskontrolle kommen wir nah an die Zensur heran. Wir müssen die engagierten Initiativen, die bereit sind, etwas zu tun und dazu auch in der Lage sind, bei ihrer Arbeit unterstützen, ohne ihnen zu sagen, was sie tun müssen.
Das ist schon klar, aber mit jeder Summe, die befürwortet wird, hat das Amt kontrolliert und eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung muß ja nach Kriterien getroffen werden.
• Es gibt natürlich eine Reihe von Faktoren, die dabei relevant sind. Das erste ist der Finanzmittelbedarf, das zweite ist die Qualität, das dritte ist die Publikumsresonanz....
...es geht um die Kriterien der Bewertung. Sind die klar formuliert?
• Die Möglichkeiten, wirklich zu disponieren, halten sich in gewissen Grenzen. Bei uns ist ja doch zur Zeit leider weitgehend eine Mangelverwaltung. Es geht doch darum: Was wir zur Zeit haben ist grundsätzlich gut, und das muß aufrechterhalten werden und es wäre schön, wir prägten noch Neues.
Die viel schwierigere Frage, ist das überhaupt gerechtfertigt, was wir tun, die kann ich nicht beantworten. Mir hat kürzlich ein Politiker gesagt, wenn jemand zu Ihnen kommt und verlangt Geld, machen Sie’s wie ich und sagen’s nein. Ich halte das nicht für unsere Aufgabe. Ich bin nicht der Schiedsrichter im Streit zwischen Fordern und Geben, sondern wir sind die Anwälte der Kultur und müssen versuchen, mit dem Gießkannenprinzip alle Pflanzen, die aus der Erde schauen, möglichst gut zu gießen. Es geht nicht darum, dem einen nichts und dem anderen etwas zu geben, es geht darum, genug Wasser in die Kanne zu füllen!
Wie erklärt man dem Klienten in einer Situation der Mangelverwaltung, daß im Festspielhaus ein Jazzfestival hoch subventioniert wird... oder wenn »Mozart 2006« aus den Kulturagenden ausgegliedert wird. Wie erklärt man das?
• Ganz konkret: Wäre ich damals Abteilungsleiter gewesen, hätte ich die Ansicht vertreten, daß die Ausgliederung von Mozart 2006 nicht richtig ist.
Ein ähnlicher Fall ist ja auch der EU-Vorsitz Österreichs. Es gibt die entsprechenden Ministertagungen in Österreich. Die Kulturstadt Salzburg hat die Außenminister bekommen und nicht die Kulturminister, die in Linz tagen. Kann man das in die Richtung interpretieren, daß Salzburg im Wettkampf mit dem innovativen Linz ziemlich alt ausschaut?
• Die Entscheidung darüber liegt in den höchsten politischen Gremien, ich kenne daher die Motive nicht. Meine Schlußfolgerung als Staatsbürger gehen natürlich in die Richtung, daß Salzburg als Punze »alte« Kultur hat. Ob zu Recht oder zu Unrecht, sei dahingestellt. Sicher zu Recht hat Linz die Punze »neue« Kultur.
Noch einmal zur Mangelverwaltung. Es war einmal vor Jahren das Ziel, die kleineren und mittleren Kulturbetriebe auf ein realistisches Förderniveau zu bringen. Diese Planung wurde eingestellt, es sind nach wie vor Mängel bei der Förderhöhe gegeben. Jetzt gibt es neue kulturelle Sektoren, die eben erst entstehen, in denen überhaupt nichts mehr möglich ist. Wie erklärt man denen, daß momentan kein Spielraum mehr da ist, aber trotzdem es keine Frage ist, daß die Osterfestspiele Fördergelder bekommen, daß die Einrichtungen der etablierten Häuser die Budgets langsam schlucken. Wie argumentiert man da, kommt der Verteilungskampf wieder?
• Da ist einiges falsch und richtig. Erstens bekommen die Osterfestspiele keine Kulturförderungsmittel. Die kommen aus einem anderen Bereich. Auch die Festspiele fallen natürlich in die Kategorie Kultur, werden aber nicht über die Kulturverwaltung verwaltet. Richtig ist auch nicht, daß die großen Institutionen in den letzten Jahren mehr Geld kriegen. Das Landestheater hat Jahr für Jahr eingespart und braucht gegenüber früher zehn Millionen weniger.
Die Fortschreibung der Subventionen, damit sich die Institutionen darauf verlassen können, diese angestrebte Drei-Jahres-Sicherung, hat es in der Praxis nie gegeben, was aus unserer Sicht sehr bedauerlich ist. Die gab es rein theoretisch beim Landestheater als Vereinbarung zwischen Stadt und Land. Das wurde dann von der Stadt einfach nicht mehr eingehalten. Es nützen also diese Versprechungen praktisch gar nichts, weil sie nicht eingehalten werden müssen. Die mittelfristige Finanzplanung, die bei uns hier im Land diskutiert wurde, ging davon aus, daß man jedem zwar dies zusichert, aber mit der Einschränkung, daß man fünf oder zehn Prozent herabsetzen darf. Das nutzt gar nichts: Wenn ich für drei Jahre vorausplane, aber riskiere, daß ich jährlich um zehn Prozent gekürzt werde, dann kann ich keine Drei-Jahres-Planung durchziehen. Damit ist die mittelfristige Finanzplanung ad absurdum geführt.
Das war aber nicht der Kern der Frage, sondern wie teilt man den Leuten mit, daß es nicht mehr Geld gibt? Ich würde das eher anders sagen: Meine ganz große Hoffnung ist, daß es uns gelingt, im Jahr 1999 wieder spürbare Steigerungen herbeizuführen, die gewisse Freiheiten bei der Subventionsgewährung ermöglichen. Ich hoffe, daß das heuer noch ein Durstjahr ist, dann soll es doch wieder spürbar besser werden.
Worauf begründet sich diese Hoffnung?
• Diese Hoffnung gründet sich auf die Erwartung, da die Leute ja nun spüren, wie schlecht es ihnen in der Zwischenzeit geht, sich bei der Politik artikulieren. Die Politik reagiert natürlich nur auf Bewegungen aus der Bevölkerung. Wenn die Bevölkerung sagt, wir nehmen das hin, dann wird die Politik keine Wohnungen, Straßen oder Kanäle bauen. Wenn sich die Bevölkerung aufregt, dann wird in diesen Bereichen eher etwas passieren. Und genauso ist es bei der Kultur. Ich warte auf diese Bewegung, die ja kommen muß. Außer die Leute sagen, es ist ja eh gleich, unternehme ich halt nichts. Das wäre allerdings fatal.
Danke für das Gespräch.